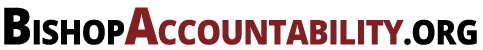COLOGNE (GERMANY)
Katholisch.de [Bonn, Germany]
August 2, 2025
By Felix Neumann
Trier/Köln/Vatikanstadt ‐ Lange waren unklare Verfahren in der Kirche dafür verantwortlich, dass Missbrauch und seine Vertuschung ungeahndet blieben. Das hat Papst Franziskus geändert. Die Prüfung der Vorwürfe gegen Kardinal Woelki folgt diesem Verfahren. Noch gibt es kein Ergebnis – doch das kann sich bald ändern.
Jetzt ist Rom am Ball: Der Trierer Bischof Stefan Ackermann hat die Anzeige des Betroffenenbeirats bei der Deutschen Bischofskonferenz gegen Kardinal Rainer Maria Woelki nach Rom weitergeleitet. Damit nimmt alles den Gang, den Papst Franziskus 2019 mit den Verfahrensregeln im Motu proprio “Vos estis lux mundi” festgelegt hat. Viel Spielraum hatte Ackermann nicht: Die Verfahrensordnung legt sowohl seine Zuständigkeit als auch seine Aufgaben klar fest.
In der Sache geht es bei der Anzeige um den Umgang von Kardinal Woelki mit der mutmaßlichen Kenntnis von Missbrauchsfällen. Der Betroffenenbeirat sieht in seiner Anzeige, die katholisch.de vorliegt, mehrere Punkte. Dazu gehören ein “nachlässiger Umgang mit Akten über mutmaßliche bzw. erwiesene Missbrauchsfälle sowie die Täuschung von Missbrauchsbetroffenen über die vorgeschriebenen bzw. möglichen Wege bei der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen und beim Verfahren zur Anerkennung des ihnen widerfahrenen Leids”, die der Betroffenenbeirat als “weitere schwere Vorwürfe” bezeichnet. Ins Zentrum stellt die Anzeige die Aussagen Woelkis vor Gericht, die zu Ermittlungen wegen Meineids und Falschaussage geführt haben, die aber letztlich gegen Geldauflage eingestellt wurde. Die Staatsanwaltschaft sah zwar einen hinreichenden Verdacht, dass der Erzbischof 2022 “fahrlässig eine falsche Versicherung an Eides Statt abgegeben und am 28. März 2023 einen fahrlässigen Falscheid abgelegt hat”. Der von ihr angenommene fehlende Vorsatz und dass Woelki bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten ist, führten aber zur Möglichkeit der Verfahrenseinstellung. Mit der Einstellung werden die Vorwürfe nicht gerichtlich geklärt. Die Einschätzung der Staatsanwaltschaft stellt keine rechtlich verbindliche Bewertung der Sache dar. In der Anzeige zeigt sich der Betroffenenbeirat “bestürzt”, dass der Erzbischof im Anschluss mitteilen ließ, nie die Unwahrheit gesagt zu haben.
Erzbistum Köln weist Vorwürfe als offenkundig haltlos zurück
Die Vorwürfe werden in der Anzeige nicht ausführlich dargelegt. Sie spricht von “von der Staatsanwaltschaft festgestellten Pflichtverletzungen”, die auch nach kanonischem Recht Straftaten darstellten. Die Anzeige nennt drei kirchenrechtliche Normen: Eine Bestimmung aus dem Motu proprio “Vos estis lux mundi”, eine aus dem Motu proprio “Come una madre amorevole” und die Generalstrafnorm c. 1399 CIC aus dem Universalkirchenrecht. “Vos estis” regelt das Anzeigeverfahren bei Sexualdelikten, “Come una madre amorevole” den Umgang mit Pflichtverletzungen von Bischöfen, und c. 1399 CIC ist eine Strafbestimmung, die immer dann herangezogen werden kann, wenn ein Verhalten strafwürdig ist, es aber keine spezielle Strafbestimmung gibt, insbesondere dann, wenn “die Notwendigkeit drängt, Ärgernissen zuvorzukommen oder sie zu beheben”. Nimmt man die angeführten Bestimmungen zusammen in den Blick, wirft der Betroffenenbeirat also dem Erzbischof “Handlungen oder Unterlassungen” vor, “die darauf gerichtet sind, die zivilen Untersuchungen oder kirchenrechtlichen Untersuchungen verwaltungsmäßiger oder strafrechtlicher Natur” bei Sexualdelikten beeinflusst oder umgangen zu haben, und zwar durch eine Amtspflichtverletzung, die durch die Öffentlichkeit ein schweres Ärgernis darstelle.
Das Erzbistum Köln wies diese Vorwürfe umgehend in einer Stellungnahme zurück: “Die vorgebrachten Anschuldigungen sind offenkundig haltlos und bauen – sicherlich unabsichtlich mangels besseren Wissens – auf einer Reihe falscher Annahmen und Behauptungen auf.” Insbesondere betont das Erzbistum, dass Woelki mit der Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft gerade nicht der Vorwürfe gegen ihn überführt wurde. Zudem sei es bei dem Ermittlungsverfahren auch nicht um Dinge gegangen, die nach kirchlichem Recht justiziabel wären. Das Verfahren habe sich nicht um “den Umgang mit Anzeigen möglicher Sexualstraftaten, der Meldung von Tätern und erst recht nicht um die Aufarbeitung von Missbrauchstaten” gedreht: “Damit kommt eine Anwendung der im Schreiben erwähnten kirchenrechtlichen Normen also überhaupt nicht in Frage.” Dass der Betroffenenbeirat von “weiteren schweren Vorwürfen” spricht, werde “im Schreiben lediglich pauschal in den Raum gestellt, jedoch in keiner Weise konkretisiert oder belegt”. Daher seien diese Vorwürfe ebenso “offenkundig haltlos und entschieden zurückzuweisen”.
Der Trierer Bischof Ackermann kommt durch die Verfahrensregeln von “Vos estis lux mundi” ins Spiel. “Vos estis” war eine Reaktion auf Defizite der Kirche im Umgang mit sexuellem Missbrauch. Das primäre Versäumnis des kirchlichen Rechts war nicht die Bewertung der Taten als Verbrechen, sondern ihre Verfolgung. Ignorieren und Vertuschen war allzu oft die Reaktion auf Verdachtsfälle. Das Motu proprio befasst sich daher damit, wie Anzeigen aufgrund von Sexualdelikten und der Umgang der kirchlichen Obrigkeit geregelt werden.
Durch die Struktur der Kirche bestanden vor allem in Bezug auf das Handeln der nur dem Papst und seiner Kurie verantwortlichen Bischöfen und Ordensoberen Kontroll- und Vollzugsdefizite. “Vos estis” rückt von der grundsätzlichen Struktur, dass ein Bischof als Vorgesetzten nur den Papst hat, nicht ab. Es gibt aber den Metropoliten, also den Erzbischöfen, die Vorsteher von Kirchenprovinzen sind, Aufgaben im Verfahren. Sie sind in der Pflicht, Anzeigen entgegenzunehmen und – zunächst formal – zu bearbeiten. Wenn Metropoliten selbst angezeigt werden – so wie jetzt bei Kardinal Woelki, der als Erzbischof von Köln der Metropolit der Kölner Kirchenprovinz ist –, geht die Aufgabe für diesen Fall an den dienstältesten Suffraganbischof über. Das ist bei den Kölner Suffraganen Aachen, Essen, Limburg, Münster und Trier der Trierer Stephan Ackermann, der seit 2009 seinem Bistum vorsteht.
Ermittlungsverfahren
Nach Eingang einer Anzeige hat Ackermann klare Pflichten, aber wenig Handlungsspielraum. Die Regeln sehen vor, dass der zuständige Bischof, der die Anzeige erhält, das vatikanische Bischofsdikasterium unverzüglich um den Auftrag bittet, die Untersuchung des Falls einzuleiten. Davon kann der Bischof nur in einem Fall abweichen: Bewertet er eine Meldung als “offenkundig haltlos”, kann er die Anzeige archivieren – und nur in diesem Fall; andere Prüfungen, etwa formale Prüfungen oder eine rechtliche Bewertung, sind nicht vorgesehen. Selbst wenn eine Anzeige als haltlos bewertet wird, muss er aber darüber das Bischofsdikasterium informieren, das dennoch ein Verfahren anordnen kann. Wenn das Erzbistum in seiner Stellungnahme zweimal von “offenkundig haltlos” spricht, nimmt es auf diese Regelung Bezug.
Bischof Ackermann hat diese Wertung als “offenkundig haltlos” nicht getroffen. Auf Anfrage von katholisch.de teilte das Bistum Trier mit, dass er die Anzeige “zur Prüfung” über den Nuntius an das Bischofsdikasterium weitergeleitet hat, also nicht nur über eine Archivierung wegen offenkundiger Haltlosigkeit informiert hat. Anders hat der Münchener Kardinal Reinhard Marx in einem anderen Fall entschieden: Eine Meldung über den Passauer Bischof Stefan Oster im Zusammenhang mit einem Streit um Vorwürfe gegen einen Priester bewertete der Erzbischof als nicht stichhaltig.
Im nächsten Schritt muss das Dikasterium tätig werden. Es hat “umgehend”, längstens innerhalb von 30 Tagen ab Eingang “angemessene Anweisungen bezüglich der Vorgehensweise im konkreten Fall zu erteilen”. Diese Anweisungen können in einem Ermittlungsauftrag an Ackermann bestehen. Wie lange es tatsächlich dauert, ist unklar: Nach der Wahl des bisherigen Präfekten des Dikasteriums, Robert Prevost, zum Papst, ist es momentan noch ohne oberste Leitung.
Grundsätzlich ist der Metropolit oder in diesem Fall sein dienstältester Suffraganbischof die Person, die mit den Ermittlungen betraut wird; das Dikasterium kann aber auch einen anderen Ermittler bestimmen. Dann muss Ackermann alle Unterlagen des Falls an diesen übergeben. Wer auch immer die Ermittlungen durchführt, muss unparteiisch den Sachverhalt erheben, Beweise sichern, Zeugen und gegebenenfalls Beschuldigte befragen. Die Ermittlungen sollen zügig erfolgen. Dazu gibt das Dikasterium eine Frist vor. Gegebenenfalls bittet er das Dikasterium darum, vorbeugende Maßnahmen gegen den Beschuldigten zu erlassen; selbst erlassen kann der Ermittler keine Maßnahmen. Am Ende übergibt er seine Akten verbunden mit einer Handlungsempfehlung an den Vatikan.
Kirchlicher Amtsenthebungs- oder Strafprozess
Mit dem Bericht des Ermittlers erlischt sein Auftrag und der Vatikan übernimmt und führt gegebenenfalls einen kirchenrechtlichen Prozess. Sollte es sich um einen regulären Strafprozess handeln, wäre bei einem Kardinal der Papst Richter. Er könnte den Prozess aber delegieren. Eine eventuelle Amtsenthebung bei Pflichtverletzungen regelt dagegen “Come una madre amorevole”. Zuständig dafür ist grundsätzlich das Bischofsdikasterium. Am Ende muss aber auch hier der Papst über Konsequenzen entscheiden.
Bisher ist außer der Meldung nach Rom noch nichts darüber bekannt, wie es nun in Köln weitergeht. Die knappen Fristen in den Verfahrensregeln stellen aber in Aussicht, dass man bald mehr weiß – und sich dann zeigt, wie es um die Vorwürfe des Betroffenenbeirats steht.Von Felix Neumann